Scheidplatz
Der Scheidplatz ist seit 1959 benannt nach Karl Friedrich Scheid (geboren am 22. Juni 1906 in Frankfurt am Main; von der SS am Kriegsende erschossen am 5. Mai 1945 am Tegernsee) war ein deutscher Psychiater und Neurologe und zuletzt Oberarzt im Krankenhaus München-Schwabing. Scheid verhandelte bei Kriegsende 1945 mit den Amerikanern erfolgreich über eine Übergabe des Krankenhauses bzw. seines Notquartiers in Tegernsee, kurz darauf wurde er durch einen Schuss der SS aus dem Hinterhalt erschossen.
Der Türkenkanal, gemalt der Blick von Höhe des Biedersteinerkanals (heute etwa Petuelring) stadteinwärts auf der Höhe des Georgenbades.

© Stadtarchiv München
In der Karte von 1864 ist unten der heutige Kurfürstenplatz mit der rot verzeichneten Burgfrieden-Grenze. Die spätere Hohenzollernstraße ist schon als Fahrweg quer eingezeichnet und die nach Nord-Westen abzweigende spätere Fallmerayerstraße ist zu erkennen. Nach Norden geht der Türkengraben, heute die Belgradstraße und irgendwo da wird in 100 Jahren der Scheidplatz entstehen.

© Stadtarchiv München
Der Verlauf der Belgradstraße folgt dem nördlichen Teil des Türkengrabens, der 1702–1704 als Verbindungskanal vom Nymphenburg-Biedersteiner Kanal zur Münchner Residenz erbaut und ab 1811 wieder verfüllt worden war. Es sollte Gondelfahrten der königlichen Herrschaft von der Residenz zum Schloß Schleißheim auf direktem Wege ermöglichen.
Die Vorgeschichte zum Scheidplatz
1764 wurde an der Verbindung von Türkengraben und Kanal erstmals die Schwaige St. Georgenschwaige (1568 St. Georgen, 1620 bei St. Georgen) genannt. 1826 wurde hier ein Freibadbetrieb aufgenommen und im ehemaligen Bleichhaus, der sogenannten „holländischen Bleiche“, entstand eine Gaststätte. 1850 gab ihr der Besitzer nach der ehemals nördlich gelegenen St. Georgenschwaige den Namen „Bad Georgenschwaige“. 1850 wurde im Münchener Tagblatt die Erteilung einer Konzession an einen Lohnkutscher für Stellwagenfahrten zur Georgenschweige bekannt gegeben. Bis zur Eingemeindung Schwabings 1890 nach München verlief die Burgfriedensgrenze um München in Höhe des späteren Kurfürstenplatzes. Im Plan der königlichen Haupt- und Residenzstadt München in seinem ganzen Burgfrieden dargestellt von 1858/59 ist die Belgradstraße zwar als „nach Georgenschwaig“ führend in ihrem südlichen Teil eingezeichnet, abgesehen von wenigen Gebäuden am späteren Kurfürstenplatz aber noch völlig unbebaut. Nach dem von der Stadt München ausgeschriebenen Stadterweiterungs-Wettbewerb von 1892 begann unter Maßgabe von Theodor Fischers Generalbebauungsplan ein Bauboom.
Die Belgradstraße auf der Höhe Hausnummer 7 - 11 im Jahr 1900.
....und der Vergleich mit heute.

.jpg)
© Archiv FMTM e.V.
Der Scheidplatz war vor seiner Gründung 1959 eine Kleingartensiedlung, die etwas nach Norden verlegt wird. Die Trambahn hat ihre Wendeschleife noch am Kölner Platz vor dem Schwabinger Krankenhaus.

© Archiv FMTM e.V.


Genau genommen kam nach einer Bauzeit vom 21.9.1910 bis 24.12.1910 am 6.1.1911 mit dem 393 m langen Hinterstellgleis vom Kurfürstenplatz die Trambahn schon ein erstes Stückchen dem zukünftigen Scheidplatz entgegen.
Nach den Bauarbeiten der Strecke in der Belgradstraße wird am 16.3.1959 die neue Schleife am Scheidplatz erreicht. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt am 19.9.1959 und bis dahin fahren alle Züge ohne Halt durch Schleife.
Baustelle in der Belgradstraße 1959 im Vergleich mit der Situation heute.
© Archiv FMTM eV.
Gleichzeitig wird die Trambahnstrecke durch die Parzivalstraße zwischen Kölner Platz und Scheidplatz gebaut und die offizielle Inbetriebnahme erfolgt am 19.9.1959.
Baustelle für die Gleise vom Kölner Platz durch die Parzivalstraße zum Scheidplatz am 19.Juni 1959

© Archiv FMTM e.V.
Blick vom Schuttberg am Luitpoldpark auf die Baustelle der ersten Schleife am Scheidplatz am 7. August 1959. Auch das neue Stationshaus auf dem Scheidplatz ist in Bau.

© Archiv FMTM e.V.
Der neue Scheidplatz vom nebenstehenden Wohnhaus am 30. Juni 1961 Richtung Norden fotografiert. Der Platz ist neu angelegt und in der Belgradstraße stadtauswärts sieht man schon die Baustelle für die neuen Trambahnlinien zum Harthof und zum Hasenbergl.

© Archiv FMTM eV.


© Archiv FMTM e.V.
© Archiv FMTM e.V.
Am 30. Juni 1961 steht noch eine Abweisblende an der Stelle in der Belgradstraße, wo ab 8.11.1963 die Strecke nach Norden verlängert werden soll.
Frisch bepflanzt zeigt sich der Scheidplatz am 17. Mai 1960 dem Fotografen.

© Archiv FMTM eV.

© Archiv FMTM eV.

© Archiv FMTM eV.
D-Wagen 489 steht im September 1965 in der alten Scheidplatz-Schleife rund um die heutige Gaststätte Holzwurm, das damalige Stationshäuschen

© Archiv FMTM eV.
Durch die Weiterführung der Trambahn Richtung Norden zum Harthof und der Eröffnung dieser Strecke am 8.11.1963 über den Oberhofer Platz und Sudetendeutsche Straße und Rathenaustraße erreichte der Scheidplatz seine erste große Ausbaustufe. Am 18.12.1964 erfolgte dann die Eröffnung der Strecke von der Rathenaustraße ab Dientzenhoferstraße über die Schleißheimer Straße zum Goldschmiedplatz (Hasenbergl).
Die Schleifenanlage am Scheidplatz war sehr komplex und machte verschiedene Betriebsabläufe möglich. Zwei Hinterstellgleise ermöglichten obendrein noch die Vorhaltung von Ersatzwagen für die Hauptverkehrszeit.

© Archiv FMTM e.V.



Diese neuen Trambahnstrecken waren die Umsetzung eines umfangreichen Verkehrsplans zur Trennung von Autoverkehr und Trambahnverkehr und die massive Erweiterung des kreuzungsfreien Trambahnverkehrs in die nach dem 2. Weltkrieg entstandenen Großsiedlungen am Hart und Hasenbergl hier im Norden und parallel im Süden nach Fürstenried. Dort wie auch hier wurden lange großzügigen Tunnel-Unterfahrungen der Verkehrsadern der Stadt geschaffen, am Petuelring unter dem neu geschaffenen Mittleren Ring in einer S-Kurve geschwungen auf der Höhe der Knorrstraße auf den Oberhofer Platz.
Der M4-Tw 2410 unterwegs auf der Linie 13 legt sich in dieser Tunnelanlage geschmeidig in die Kurve. Der Tunnel war mit einer Ampelanlage ausgerüstet.
© Archiv FMTM e.V.
© Archiv FMTM e.V.
© Archiv FMTM e.V.
Im Februar 1969 sind zwei Verstärkerzüge mit den D6-Tw 484 und 488 in der Schleife am Scheidplatz hinterstellt für den Betrieb in der Hauptverkehrszeit weiter zum Hasenbergl

© Archiv FMTM e.V.
Am 19.10.1971 wird die Strecke durch die Parzivalstraße zwischen Leopoldstraße und Scheidplatz wegen der Inbetriebnahme der neuen U-Bahnlinie 6 (Kieferngarten - Goetheplatz) stillgelegt. Als Betriebsstrecke zum bereits stillgelegten Depot 4 an der Soxhletstraße bleibt sie aber noch bis zum 4.5.1972 befahrbar.
Am 4.5.1972 wird dann die komplette, gerade mal 13 Jahre alte, Schleifenanlage östlich der Belgradstraße auf dem Scheidplatz bedingt durch die neue U-Bahnstation aufgegeben und durch die neue westlich gelegene Schleifenanlage ersetzt.

Seit 1968 wird am Scheidplatz die U-Bahnstrecke von der Münchner Freiheit zum Olympiagelände gebaut. München ist 1972 Olympiastadt und so wurde diese Linie nötig.

© Archiv FMTM e.V.

© Archiv FMTM e.V.
Schöne neue Welt am Scheidplatz: Der geplante Betriebsablauf auf dem neuen Scheidplatz mit der U-Bahn drunter und für Trambahn und Bus auf der neu gestalteten Oberfläche von 1972: Die Gleisanlage ist so ausgeführt, dass es praktisch keinen durchgehenden Verkehr mehr gibt. Zwei Wendeschleifen von einwärts und auswärts werden in die Bahnhofanlage geführt und haben in jeder Richtung Doppelgleise für Einsatzwagen und Ausweichen sowie umkehrende Fahrzeuge. Die Anbindung der Parzivalstraße ist ersatzlos gestrichen worden.

© Archiv FMTM e.V.
P3-Tw 2031 auf der Linie 8 und M3-Tw 2322 auf der Linie 2 an der neuen Haltestelle Scheidplatz im März 1974

© Archiv FMTM e.V.

© Archiv FMTM e.V.
Der Streckenplan der Schleifenanlage Scheidplatz vom 10. Mai 1985 mit Kommentierungen. Bis zum 18.10 1980 war der darunterliegende U-Bahnhof mit vier Gleisen für eine durchgeführte Linie etwas überdimensioniert. Ab jetzt kommt die neue U-Bahn vom Hauptbahnhof durch Schwabing zum Scheidplatz. Das hat natürlich auch Einfluss auf viele über den Scheidplatz geführten Trambahnlinien. Deshalb wiederum erweisst sich die Streckenführung über den Knoten Scheidplatz zunehmend als etwas umständlich. Als am 21.11.1993 dann die U-Bahn vom Scheidplatz weiter zum Hasenbergl eröffnet wird und die nördlich des Scheidplatzes agierenden Trambahnzubringer stillgelegt wurden, war es Zeit für einen weiteren Umbau der Gleislage auf dem Scheidplatz für die nun nur noch vom Süden aus der Stadt kommenden Trambahnlinien.
Wurde die alte Scheidplatz-Schleife bis April / Mai 2003 in ihrer verbliebenen Form genutzt, wurde sie jetzt durch den Rückbau der Gleise und den Rückbau der Weichen 488 (auswärts) sowie 492 (einwärts), die durch gerade Gleisstücke ersetzt wurden, modifiziert und verkleinert und die freiwerdenden Verkehrsflächen für Busse nutzbar gemacht, soweit das nicht vorher schon der Fall war.
Belgradstraße
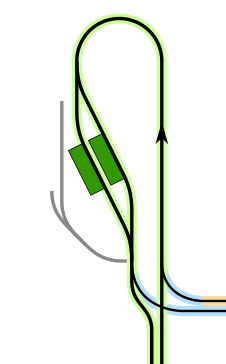
Parzivalstraße
ab 12.12.2009
Schleife
Scheidplatz
© Reinhold Kocaurek
© Reinhold Kocaurek


Zurück blieben noch viele Jahre die von Fotografen so geliebten "Lost Tracks" an verschiedenen Stellen des mit mehr Grünflächen neu gestalteten Scheidplatzes, die ins Nirgendwo zu führen scheinen. Erst in der Zeit vom 22.4.2014 bis 26.4.2014 erfolgt der Rückbau der letzten Gleisreste der alten Linie 13.
Zusätzliches Leben auf den Scheidplatz kommt erst wieder vom 16.7.2007 bis Dezember 2007, als die Parzivalstraße wieder zur Betriebs-Verbindungsstrecke zur neuen Trambahnlinie 23 in der Leopoldstraße wird. Es erfolgt die Erneuerung beider Weichen am Überholgleis und der Einbau einer Doppelgleisabzweigung von Schleife zur Parzivalstraße. Am 12.12.2009 ist dann die Wiederinbetriebnahme des Betriebsgleis Parzivalstraße zwischen Leopoldstraße und Scheidplatz als Zufahrtsgleis für die Linie 23.
Das alte Stationshaus Baujahr 1960 ist das letzte Zeugnis der damaligen Kehrschleife am Scheidplatz in den 60er-Jahren.

© Reinhold Kocaurek 2012
M4-Tw 936 auf der Linie 2 an der alten Schleife an der Endhaltestelle Scheidplatz im Juli 1971


Flotte 13 Jahre verbrachte die Linie 2 vom 11.04.1965 bis zum 06.10.1978 am Scheidplatz.
© Archiv FMTM e.V.

Der 08.09.1959 war für die Linie 3 und den Scheidplatz der Start einer Freundschaft bis zum letzten Betriebstag der Linie 3 am 20.04.1968.
Der Tatzelwurm P1-Tw 101 unterwegs auf der Linie 3 an der Endhaltestelle Scheidplatz10.5.1962

© Archiv FMTM e.V.

Der beginnende U-Bahnbau vertrieb die Linie 6 zum Scheidplatz vom 14.08.196 bis zum letzten Betriebstag der Linie 6 am 27.05.1972.
Linie 6 mit einem Einsatzwagen M4-Tw 967 + m4-Bw 1792 am Scheidplatz am 26.7.1971

© Archiv FMTM e.V.

Seit der Eröffnung am 08.09.1959 des Scheidplatz ist auch die Linie 8 hier heimisch bis zu ihrer Einstellung am 22.11.1975.
M3-Tw 853 auf der Linie 8 und M4-Tw 886 der Linie 3 am Scheidplatz kurz nach der Eröffnung am 25.9.1959

© Archiv FMTM e.V.

Platzhirsch seit dem 23.11.1975 ist die Linie 12 Scheidplatz in verschiedenen Rollen zuerst vom Harthof kommend und bis heute zum Romanplatz unterwegs.
Der M3-Tw 2334 auf der Linie 12 an der Haltestelle Scheidplatz auswärts 9.3.1979

© Klaus Onnich

Auf der neuen Schleife am Scheidplatz begann die Linie 13 ihre Karriere am 09.05.1972 als Hasenberg-Klassiker Hasenbergl - Oberhofer Platz - Scheidplatz
mit letztem Betriebstag am 20.11.1993.
Tw 2021 der Linie 13 am neuen Scheidplatz im Mai 1972

© Archiv FMTM e.V.

Mit der Linie 15 ging es vom 23.11.1975 bis zum 19.10.1980 nach Großhesselohe und ab und zu sogar bis Grünwald.
Linie 15 mit dem M5-Tw 2660 an der Endhaltestelle Scheidplatz am 6.3.1979

© Archiv FMTM e.V.

Für die Linie 18 gabs eine Haltestelle am Scheidplatz vom 01.02.1971 bis zum 30.06.1972 und nochmal vom 27.07.1989 bis zum 09.09.1989.
Der M4-Tw 974 + m4-Bw 1780 der Linie 18 steht am Ratzingerplatz einwärts am 2.6.1971 zur Fahrt zum Hasenbergl über den Scheidplatz.

© Archiv FMTM e.V.
Die Linie 23 mit Tw 2520 + Bw 3544 an der Rathenaustraße einwärts mit Zielschild "Scheidplatz" am 28.09.1973

© Archiv FMTM e.V.
M3-Tw 2310 + m3-Bw 3338 der Linie 25 mit P3-Tw 2027 der Linie 13 am Scheidplatz im September 1977

© Archiv FMTM e.V.

Während des Umbaus der Schleife am Petuelring fand die Linie 27 vom 16.09.1996 bis zum 24.11.1996 Asyl am Scheidplatz.
Klaus Werner erwischte in einem Video die Linie 27 mit Tw 2607 am Scheidplatz am 20.11.1996

© Klaus Werner

Reingeschmeckt in den Scheidplatz hatte die Linie 28 schon vom 16.10.1960 bis 28.03.1964 nur in der Hauptverkehrszeit. Seit 10.12.2012 ist sie bis heute Stammgast hier am Scheidplatz.
Seltene Begegnung am 25.11.2014 am Scheidplatz: Während der P-Gelenkzug 2031/3037 über das Hauptgleis ausweicht, steht der Zug 2005/3039 zur Unfallaufnahme im Nebengleis

© Klaus Werner
U-Bahn am Scheidplatz


Der viergleisige Kreuzungsbahnhof Scheidplatz im Stadtteil Schwabing-West ist wie die anderen Bahnhöfe der Olympialinie U3 in damals beliebter Sichtbetonoptik ausgeführt. Geplant wurde er vom U-Bahn-Referat, die Sichtbetonreliefs an den Bahnsteigwänden wurden von Waki Zöllner gestaltet Die ersten neun Jahre seines Betriebs wurde der Bahnhof nur von der Linie U3 durchquert, die Linie U2 (ursprünglich U8) erreichte den Scheidplatz erst 1980. Aus diesem Grund waren ursprünglich auch nicht alle Gleiströge mit Gleisen ausgestattet und nicht alle Weichenverbindungen vorhanden. Diese wurden erst später eingebaut. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind U2 und U3 so getaktet, dass bahnsteig- und zeitgleich zur jeweils anderen Linie umgestiegen werden kann. Während der Hauptverkehrszeiten erlaubt die verschiedene Taktung von U2 und U3 dies leider nicht immer. Bis zur Eröffnung des Linienastes Richtung Feldmoching war der Scheidplatz Umsteigebahnhof zu den hier beginnenden Tramlinien ins Hasenbergl und zum Harthof.


© Joseph Baienz 1972

© Reinhold Kocaurek 1972
Mehrere Schulen sowie das Krankenhaus Schwabing befinden sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und werden durch den Bahnhof erschlossen. Die Leitfarbe orange findet sich an den Rolltreppen, dem Linienband der U3 sowie der Bahnsteigmöblierung wieder. Ende der 1990er Jahre wurden die ursprünglichen, orangefarbenen Plastikschalensitze gegen modernere und beständigere Sitzmöbel aus Drahtgitter getauscht, leider nicht mehr in Linienfarbe. Die hohe Bahnsteighalle wirkt sehr hell und luftig, selbst die nachgerüsteten Aufzüge zerstören die Sichtbeziehungen nicht zu stark. An den Bahnsteigenden sind die Wandflächen mit tiefblauen Majolikafliesen mit roten Meerestieren verkleidet. Die Wandreliefe von Waki Zöllner zeigen fensterartig vorbeifahrende U-Bahnzüge in sehr detailreicher Darstellung, sie wurden als negative direkt in die Schalung der Außenwände eingebracht.
.jpg)
Text & Bilder: Florian Schütz | www.u-bahn-muenchen.de


