Karlsplatz Stachus


© Stadtarchiv München
Das westlichste Stadttor Münchens ging 1613 über den Burggraben auf die Krautacker und Hopfengärten und die Schießstätte des Herrn Stachel (daher auch der Name Schützenstraße) vor der Stadt.
Vergangenheit trifft Technik von heute: aus 4 Glasplatten-Photos aus dem Jahr 1902 aus einem Fenster im 4.Stock des Hotels Stachus fotografiert kann man heute ein wundervolles Zeitdokument zusammenbauen: der Stachus im Jahr 1902 im Panorama.

© Stadtarchiv München
Analog meets digital: als ein Fotograf mit kiloschweren unförmigen Aufnahmeapparaturen 1902 vier Glasplatten aus dem 4. Stockwerk des Hotels nacheinander immer wieder etwas weiter nach rechts gedreht belichtete, konnte er nicht ahnen, daß wir das einfach digitalisieren und in Photoshop mit einer Automatik zu diesem wunderbaren Panorama zusammenführen werden.
Nach seiner Anlage 1791 hieß der Platz offiziell nach dem an ihm gelegenen Tor zunächst „Neuhauser-Tor-Platz“, ähnlich wie heute noch der Isartorplatz und der Sendlinger-Tor-Platz. Es wurde um 1300 erbaut und nach dem Abbruch des Hauptturms 1861 bis 1862 durch Arnold Zenetti im neugotischen Stil umgestaltet. Nachdem das Neuhauser Tor im Juli 1792 zu Ehren des bayerischen Kurfürsten Karl Theodor in Karlstor umbenannt worden war, behielt der Platz zunächst seinen alten Namen, erst im Februar 1793 ist der Name „Karls-Thor-Platz“ belegt. Am 27. April 1797 genehmigte Karl Theodor die Umbenennung des Platzes in Karlsplatz. Dass der Pfälzer Kurfürst bei den Münchnern äußerst unbeliebt war, ist vielleicht ein Grund dafür, dass der alte Name „Stachus“ weiter in Gebrauch blieb. Das Karlstor (bis 1791 Neuhauser Tor genannt) ist das westliche Stadttor der historischen Altstadt von München.
Um uns hier auf die Trambahn-Geschichte konzentrieren zu können sind die heimatkundlichen Nebenschauplätze auf die nebenstehende Seiten verlinkt:
Im Westen zwischen Elisenstraße und Prielmayerstraße steht der Justizpalast.
Anschließend zwischen Prielmyerstraße und Schützenstraße steht der Königshof.
Zwischen Schützenstraße und Bayerstraße steht das PINI-Haus
An der Ecke Bayerstraße und Sonnenstraße steht der Kaufhof.
Auf der Sonnenstraße südlicher Abschluß des Stachus stand die Matthäuskirche.
Den südlichen Anschluß der Grünanlagen vor dem Justitzpalast machte Nornenbrunnen
Der nördliche Abschluß des Stachus ist der Lenbachplatz, früher der Dultplatz.
Die Verkehrsplanungen der 50er-Jahre hatten viel vor mit dem Stachus

Im Jahr 1848 war der freie Platz außerhalb der Stadtmauern gut für einen Zirkus zu gebrauchen: der Zirkus Knie gastierte in einem arabischen Zelt auf dem Karlsplatz Stachus.
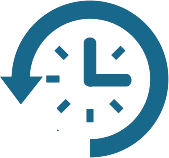
© Stadtarchiv München
Im April 1874 wurde der erste Entwurf einer Pferdetrambahn für München gezeichnet und der Stachus war natürlich mit dabei. Dieser schwungvolle Streckenplan wurde allerdings nie umgesetzt.

© Stadtarchiv München
Die erste Pferdetrambahnstrecke führte ab 21.10.1876 vom Lenbachplatz über den Karlsplatz in Doppelspur weiter durch die Bayerstraße zum Hauptbahnhof. Die Bauzeit betrug 3 Monate. Der Stachus war einer der ersten gepflasterten Plätze in München.

© Stadtarchiv München
Vom 29.06.1877 gab dann schon ein Jahr später die Strecke durch die Sonnenstraße zwischen Karlsplatz und Sendlinger-Tor-Platz ebenfalls in Doppelspur. Auf dem Foto kommt gerade ein Wagen aus der Sonnenstraße und biegt in die Bayerstraße zum Centralbahnhof.
__Stachus__(1880)__(0001_01)__B.jpg)
© Stadtarchiv München
__Stachus__(1891_-_1892)__(0001.jpg)
%20%20Stachus%20%20(1895)%20%20(0001_01)%20%20K.jpg)
© Stadtarchiv München
© Stadtarchiv München
Daß in dieser Epoche fast alle Bilder vom Stachus die Perspektive mit Hotel Bellevue (später Königshof) und Hotel Stachus zeigen, hat einen guten Grund: der Stachus war kein sehr prunkvoller Platz. Das zeigt ein ungewöhnlicher Blick von der damaligen Mathäuskirche (Sonnenstraße etwa Höhe der Schwanthalerstraße): an Stelle des Justizpalastes stand eine Kaserne, dahinter der Glaspalast, dahinter am Lenbachplatz keine Prunkbauten und das Stachusrondell bestand aus einfach Wohnhäusern.
Das Karlstor war Ende des 19. Jahrhunderts noch recht versteckt in die städtische Wohnbebauung integriert. Das Treiben auf dem Platz war durchaus ländlich und bürgerlich.
Der Glaspalast war ein 1854 erbautes Ausstellungsgebäude auf dem Gelände des Alten Botanischen Gartens in der Münchner Innenstadt. Ursprünglich war geplant, das Gebäude am Maximiliansplatz zu errichten. Die Entscheidung der zuständigen Kommission fiel jedoch auf ein Areal in der Nähe des Bahnhofs. Nach Plänen des Architekten August von Voit wurde das Gebäude 1854 im Norden des Alten Botanischen Gartens nahe dem Stachus errichtet.
© Sammlung Stadtarchiv München
Ab 5.5.1888 gab es auf der Strecke vom Karlsplatz zur Luisenstraße über die Elisenstraße zum Bahnhofsplatz einen Neubau eines einfachen Gleises für eine provisorische Sonderlinie, die den Glaspalast und die Kunstausstellung am heutigen Mariannenplatz für die Veranstaltungszeit verband.
Ab dem 1.11.1888 wurde diese Strecke Karlsplatz - Luisenstr. - Elisenstr. - Bahnhofplatz aufgelassen, da die Kunstgewerbeausstellung beendet war und kein Sonderverkehr mehr notwendig war.



Diese Panoramaufnahme vom Stachus ist datiert mit 1880 und zeigt einen recht ruhigen Tag damals.
© Stadtarchiv München
Eine weitere Pferdetrambahn-Verbindung geht nach einer Bauzeit 4 Wochen am 16.06.1888 in Betrieb: auf der Strecke Karlsplatz - Neuhauserstraße - Kaufingerstraße - Marienplatz geht eine Doppelspurstrecke in Betrieb, die jedoch in der Kaufingerstraße zwischen Färbergraben und Liebfrauenstraße auf 113 m nur einspurig läuft.

© Stadtarchiv München
Auf diesem Bild von 1890 sieht man nun die Schienen der Pferdebahn in Richtung Marienplatz auf dem Stachus.

© Stadtarchiv München
1890 wurde vor dem Hotel Bellevue ein Blumenkiosk gebaut. Diese Funktion behielt es bis 1906 als es von der Trambahn als Stationshaus übernommen wurde.

© Stadtarchiv München
Das handgeschriebene Original des Sommer-Fahrplans 1895 für die Strecke von der Forstenriederstraße zum Stachus.

© Stadtarchiv München
Ab dem 1.4.1896 dient eine provisorische Strecke durch die Prielmayerstraße zwischen Bahnhofsplatz und Karlsplatz wegen Kanalisierungsarbeiten in der Bayerstraße als Ausweichroute. Die Wiederaufnahme des Planbetriebes durch die Bayerstraße erfolgte am 25.6.1996. Das Bild zeigt die Pferdetrambahn auf dieser Ausweichroute und am linken Bildrand sieht man die Baustelle an der Strecke zur Bayerstraße.

© Stadtarchiv München
Der Justizpalast als monumentales repräsentatives Gebäude am Stachus und allemal ein beliebtes Fotomotiv wird nach mehrjähriger Bauzeit eröffnet. In der Folge verschwinden das Klemensschlösschen und die Tage des alte Stachusrodells sind gezählt.

© Stadtarchiv München
Das Klemensschlösschen war letzter Teil der Kadettenschule, die dem Justizpalastt Platz machen mußte. Dieser Gebäudeteil stand aber noch ein paar Jahre auf dem Stachus.

Erstmal erwähnt ist es 1752 und ab 1804 der Amtssitz und Wohnung des Hofgartenintendaten Friedrich Ludwig von Sckell. Ab1827 wurde es für das Kadettenkorps erweitert. Um 1895 wurde es für den Bau des Justizpalastes abgebrochen.
Eine Gedenktafel für das Schloss befindet sich unter dem Erdgeschossfenster des nordöstlichen Risalits des Justizpalastes.
Das Klemensschlösschen
Herzog-Clemens-Gartenpalais oder auch Clemensschlössl genannt.

© Stadtarchiv München
© Stadtarchiv München
Die Elektrische kommt auch auf den Stachus: am 23.6.1898 wird die Strecke Bayerstraße zwischen Karlsplatz und Bahnhofplatz elektrifiziert nach einer Bauzeit vom 25.4. - 22.6.1898.
Ein seltenes Dokument mit Mischbetrieb von Pferdetrambahn und elektrischem Betrieb auf dem Stachus: die Linie zum Lenbachplatz rechts wurde erst 1900 elektrifiziert, die Strecke vom Hauptbahnhof zum Marienplatz war schon elektrisch.

© Stadtarchiv München
Gerade fährt die Elektrische auf der Linie I, der weißen Linie, vom Stachus durchs Karlstor zum Marienplatz.

© Stadtarchiv München
Kurz darauf erfolgt am 13.7.1898 auf der Strecke in der Sonnenstraße zwischen Karlsplatz und Sendlinger-Tor-Platz die Aufnahme des elektrischen Betriebs und auch der Oberleitungsbau in Lindwurmstraße fand vom Sendlingertorplatz bis Ruppertstraße vom 21.3. - 28.6.1898, statt der übrige Bereich war schon am 10.6.1898 fertig.


Die Strecke durch die Sonnenstraße ging bis 1953 nur auf einer Seite der Sonnenstraße entlang Richtung Sendlingertorplatz. Das Bild ist mit 1903 datiert. Wir befinden uns an der Stelle des Gleiswechsels.
© Archiv FMTM e.V.
© Archiv FMTM e.V.
1882 bis 1906 bestand eine Trambahnstrecke am Wittelsbacher Brunnen (gebaut 1893–1895) am Lenbachplatz vorbei zur Ottostraße.
Unser Bild zeigt eine Pferdebahn auf dieser Strecke, Sie wurde 1906 aufgelassen, als die Strecke durch die Bernheimer Klamm gebaut war.

© Archiv FMTM e.V.
Eine sehr seltene Perspektive zeigt dieses Bild, das ungefähr an dem Ort gemacht wurde, wo im oberen Bild die Pferdebahn fuhr: die Maxburg und rechts das Künstlerhaus

© Stadtarchiv München
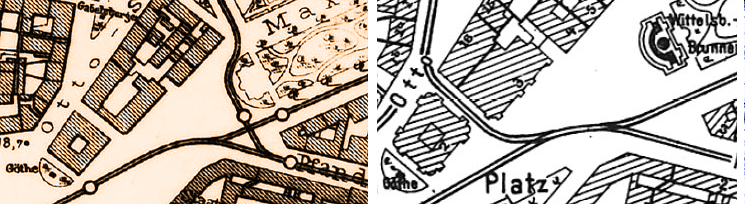
© Archiv FMTM e.V.
Bernheimer Klamm
© Archiv FMTM e.V.

Gleisanlage Lenbachplatz bis 1899
Gleisanlage Lenbachplatz ab 1899 bzw. 1906 (zweigleisig)
im Mai 1899 wird am Lenbachplatz die Strecke durch die Bernheimer Klamm zwischen Lenbachplatz und Ottostraße in Betrieb genommen, zunächst eingleisig, ab 15.8.1900 wird hier die letzte Pferdetrambahn-Linie eingestellt und auf elekrischen Betrieb umgestellt. Zweigleisig wird die Bernheimer Klamm erst am 12.7.1906 mit dem großen Umbau der Gleisanlagen auf dem Stachus.
Auf der letzte Strecke begann am 19.2.1900 der elektische Betrieb auf der Strecke Lenbachplatz - Karlsplatz, Baubeginn war dir im Jahr zuvor am 9.6.1899.

Der große Umbau des Stachus steht an von März bis Juni 1906 wird im nördlichen Teil des Stachus eine Schleife eingebaut und gleichzeitig eine Strecke zum Hauptbahnhof durch die Prilmayerstraße am
2.5.1906 eröffnet. Am 12.7.1906 wird damit auch die Strecke durch die Ottostraße zum Karlsplatz in Betrieb genommen.
Dadurch verändert der Stachus sein Erscheinungsbild komplett. Dieses Gleisbild wird für die nächsten 50 Jahre den Platz prägen.

© Stadtarchiv München

© Archiv FMTM e.V.

© Archiv FMTM e.V.
Blick 1906 vom Imperialhaus zwischen Schützen- und Bayerstraße Richtung Stachus

© Stadtarchiv München

© Stadtarchiv München
An einem Sonntag im Juli 1907 ist der Stachus gut belebt und wenn man genau schaut, kann sogar schon ein Auto erkennen. Autos durften damals in München nur Schrittgeschwindigkeit fahren.
Verkehrs-Statistik aus dem Jahr 1906/1907: neben dem Hauptbahnhof ist die Achse Sendlingertor-Platz zum Stachus die meistfrequentierte Strecke in der Stadt.

Der Stachus mag einer der meistabgebildeten Ansichtskarten-Motive der damaligen Zeit sein: aus allen Richtungen wurde er Jahr für Jahr dokumentiert, - gut für uns heute. Allerdings sind die Aufnahmejahre oft schwer zu ermitteln, denn die Buchführung der Fotografen war lückenhaft. So gehen wir oft nach den abgebildeten Wagen, Liniennummern und baulicher Zustände.

© Archiv FMTM e.V.
Verkehrsplanung 1912: es werden Verkehrsweg-Änderungen genau kalkuliert und fließen in die Gesamtbewertung ein, wie das Schreiben von dem Trambahn-Direktor Dix beschreibt.

© Stadtarchiv München
Der 1. Weltkrieg und die Folgen
Als erster deutscher Monarch war am 7. November 1918 der bayerische König Ludwig III. geflohen. Damit ging das mindestens seit 919 (es gibt unterschiedliche Anfangsdaten) in Bayern etwa 1000 Jahre existierende und seit 1180 herrschende Adelsgeschlecht der Wittelsbacher zu Ende. Kurt Eisner von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) rief den Freien Volksstaat Bayern aus und wurde vom Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat zum ersten Ministerpräsidenten der bayerischen Republik gewählt.
Ab Mitte April 1919 griffen vom inzwischen nach Bamberg ausgewichenen Kabinett Hoffmann zu Hilfe gerufene Freikorpseinheiten, vereinzelt auch als Weiße Truppen bezeichnet, die Verteidiger der Räterepublik an und eroberten zusammen mit aus Berlin entsandten Reichswehrverbänden München bis zum 2. Mai 1919 zurück. Im Laufe der Kämpfe kam es zu Grausamkeiten, bei denen hunderte Menschen starben, in der Mehrzahl als Opfer der Freikorps.

© Stadtarchiv München
Unter anderem brannte am 1.5.1919 das Stationshaus der Trambahn am Stachus und der Matthäser in der Bayerstraße.

© Stadtarchiv München

© Stadtarchiv München

© Stadtarchiv München
Bestandsaufnahme nach dem Brand 1919 im Stationshaus am Stachus: die Läden und Betriebsräume sind komplett verwüstet.
Der Trambahnbetrieb in schweren Zeiten
Durch die Einberufung eines Großteils des Personals kam es zu einem stark beschnittenen „Kriegsfahrplan“ mit Einstellung der meisten Verstärkungslinien und einer Verkürzung mancher Stammlinien. Ab 1915 ersetzte man die Schaffner auf den Fahrzeugen nach und nach durch Frauen, ihre Zahl stieg bis auf 770, die dann nach Kriegsende wieder durch Männer ersetzt wurden. Durch die Finanznot und den Materialmangel, der nicht nur die Reparatur der Wagen sondern auch des Gleismaterials unmöglich machte, war auf Jahre hinaus nicht mehr an einen systematischen Streckenneubau oder auch nur einfache Streckenerweiterungen zu denken.

© Stadtarchiv München
Die Matthäser Bierhallen brennen im Mai 1919

© Stadtarchiv München
Neue Strecken wurden nur noch zu kriegswichtigen Betrieben, wie Waffen- und Munitionsfabriken, eingerichtet. Gewaltig war die Materialbeschlagnahme, allein 2650 Tonnen Kupfer. 26 Tonnen Fahrleitung mussten durch Eisendraht ersetzt werden. Folge der Kriegsereignisse war 1916 eine Verbindung des Trambahnnetzes an die Eisenbahnanlagen, um zur Treibstoffersparnis innerstädtisch provisorisch umgebaute Straßenbahnwagen als Güter- und Lazarettzüge verkehren zu lassen. Dazu wurden auf den Fahrbahnen behelfsmäßig Schienen verlegt. Gegen Ende des Krieges konnte nur noch ein stark reduzierter Notverkehr aufrechterhalten werden.

Auf dem Stachus sind inzwischen auch Doppelstockbusse neben den Trambahnen unterwegs. Autos sind weiter die Ausnahme.
© Stadtarchiv München
Der Gleisplan des Stachus im Jahr 1920: die komplexe Schienenanlage beherrscht den Platz und der Trambahnverkehr hat es neben den Pferdefuhrwerken und Droschgenverkehr zunehmend mit Autoverkehr zu tun.

© Archiv FMTM e.V.
Der Blick 1924 aus der Bayerstraße auf den Stachus: sein Ruf als verkehrsreichster Platz Deutschlands ist noch weit entfernt, aber es geht schon äusserst geschäftig zu: man teilt sich die Straße, Trambahnen, Fussgänger, Autos und Radfahrer auf dem harten Straßenpflaster. Mit Linien versucht man den Verkehr zu leiten.

© Stadtarchiv München
Ungewohnter Perspektive: Blick über den nördlichen Teil des Stachus Richtung Ottostraße und Lenbachplatz.
%20%20Stachus%20%20(1920~)%20%20(0001_01)%20%20.jpg)
© Stadtarchiv München
© Stadtarchiv München

Der Optiker Heinrich Haas (1874 bis 1929) war eine Berühmtheit und bekannt als der "Fernrohrmann vom Stachus": als volkstümlicher Astronom stand er mit seinem Fernrohr am Stachus und gegen Gebühr ließ er Passanten das Firmament betrachten und hielt dazu einen kleinen Vortrag.
Der Fernrohrmann vom Stachus

© Stadtarchiv München
Im Jahr 1925 war es eine fotografische Kunst, Nachtaufnahmen zu machen. Im Winter 1925 nutze der unbekannte Fotograf dieses Bildes den leichten Schnee und eine lange Belichtungszeit, um dieses gelungene Bild zu erstellen. Deutlich sind die schneefreien Flächen unter den warmen Triebwagen an den Haltepunkten zu sehen.
Zu den A-Wagen gesellen sich nun auch die neuen ab 1908 gebauten B-Typ Wagen und ab 1910 gebauten Typ-C Wagen.

© Archiv FMTM e.V.
Der C 4-Triebwagen 437 + c-Bw im Jahr 1925 auf der Linie 20 vor dem Justizpalast am Karlsplatz-Nord Richtung Schwabing.

Im Jahr 1930 ergeben sich erste Bedenken über eine mögliche Hochhausbebauung Münchens mit einer Bildmontage des Stachus mit der einer neuen Skyline. Das Thema ist seit dem für Münchne stets aktuell geblieben

Weihnachtsgeschäft 1934 im Kaufhaus Horn: das Hotel Stachus hat die unteren Etagen an das Kaufhaus Horn verpachtet, dessen Stammhaus am Hauptbahnhof (heute Hotel Deutscher Kaiser) . Heute steht hier der Kaufhof.

%20%20Stachus%20%20(1937~)%20%20(0001_01)%20%20.jpg)
© Stadtarchiv München
Blick 1938 vom Justizpalast Richtung Süden in die Sonnenstraße. Noch steht hier die Matthäuskirche. Die politischen Entwicklungen in Deutschland und Bayern denken größer: die Planungen sehen breite Straßen und Boulevards vor und diesem Gedanken steht die Matthäuskirche im Weg. Sie wird 1938 kurz nach diesem Foto abgerissen.

Der Stachus auf einer Postkarte 1940 ein letztes Mal in seiner Pracht der Vorkriegszeit wirkt fast friedlich.

© Archiv FMTM e.V.

Der Justizpalast ist 1897 gerade fertiggestellt, als dieses Foto gemacht wurde: ein Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes endete der Pferdebahn-Betrieb.

© Stadtarchiv München
1901 wird am Stachus auf der Südseite zu den gerade neu fertiggestellten Rondellbauten ein Pavillon gestellt, in dem neben einem Zeitungskiosk und einer Wäscherei und anderen Geschäften noch eine Toilettenanlage untergebracht ist.

© Stadtarchiv München
